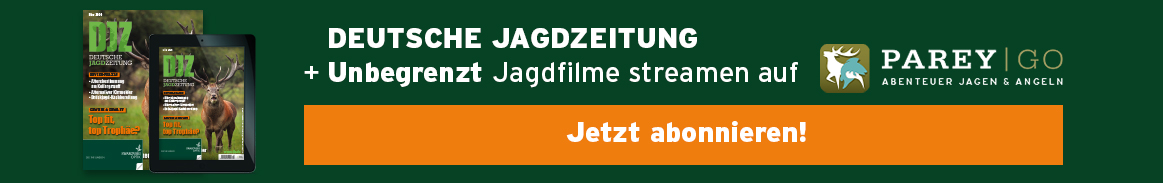DJZ vor Ort bei Leopold Graf Deym in der September-Ausgabe. Als der 2. Weltkrieg beendet war, stand es schlecht um die Jagd in Deutschland. Waffen waren strengstens verboten, und die Besatzer „wilderten“ nach eigenem Ermessen. Unter dem Titel „Jagd zwischen Krieg und Frieden“ hat der 79-Jährige seine persönlichen Erinnerungen an diese Zeit zusammengefasst:
In der Mitte des zweiten Kriegsjahres (1940) landete ich mit einem vitalen Schrei im Garten Eden. Leider zogen schon bedrohlich schwarze Wolken auf. Bedingt durch die knappe Auswahl an Männern hielt mich mein Großvater mütterlicherseits in der Pfarrkirche bei Geistlichem Rat Busler über das Taufbecken. Großvater „Effendi“ verbrachte nach spannenden Jahren in der Türkei seinen „Austrag“ bei uns. In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg war auch Mutter noch am Bosporus geboren.
Großvater diente schließlich beim türkischen Heer, verantwortlich für Ernährung, und nahm dann zum Schluß seinen Abschied als kaiserlich osmanischer Major. Spannende Jagdgeschichten begleiteten seine Zeit in Vorderasien, die ihm den Titel „Effendi“ eingetragen hatten. So ein bißchen erinnerten die Erzählungen an Karl Mai. Von seinen Erfahrungen und Künsten profitierten auch wir in den folgenden schlechten Kriegszeiten. Er schoß mit der Kugel Hechte, baute in Waldlichtungen Topinambur an und kultivierte Tabak.
Daß die Jagdpassion über die Muttermilch in mir grassierte, ist weniger wahrscheinlich, als daß sie Folge von Begegnung und Erziehung war. So beginnen meine ersten Erinnerungen und Schritte ins Waidwerk mit„Effendi“. Mit 4 Jahren nahm er mich auf seinem großen Fahrradgepäckträger mit auf die Jagd. Ich sehe noch heute wie an der „Schäferhäng“ ein getroffener Rehbock senkrecht in den Himmel steigt und am Mühlberg eine Riesenente von dort abstürzt. Ein frühkindliches Trauma blieb Gott sei Dank aus. Nur physisch war ich den Anforderungen noch nicht gewachsen. U.a. verlor ich einen einäugigen Feldstecher, dessen Verlust ich heute noch bedauere. Großvater war nicht nur passionierter Jäger, sondern auch großer Naturkenner und -liebhaber. Herzog Albrecht – später selber anerkannter Wildbiologe – verehrte ihn als seinen Lehrmeister, gerüchteweise aber auch seine Töchter, welche war umstritten.
Auch mein Vater gehörte zu den wenigen Männern, die damals noch zu Hause jagen konnten. Er war wegen der Landwirtschaft zunächst u. k. (unabkömmlich) gestellt. Auch wenn er sehr dosiert Jagdpassion besaß, hatte ich auch mit ihm frühe Jagderlebnisse. An der „Kreuzquanten“ saß bei einem Jagdspaziergang ein Flug Tauben auf dem Feld, die er von der nahen Remise aus beim Auffliegen erlegen wollte. Dazu sollte ich alleine hinaus laufen und sie aufscheuchen. Obwohl ich furchtbar geheult habe, beugte ich mich schließlich dem väterlichen Wunsch und tat das Geheißene. Es fehlte die Begeisterung und so blieb der Erfolg versagt. Außergewöhnliches Waidmanns Heil hatte Vater in den Kriegsjahren allerdings auf einen Rothirsch, der sich zu uns verlaufen hatte und auch in der Küche sehr willkommen war. Seit den Revolutionsjahren 1848, wo vielleicht der „Hirschengraben“ noch ein letzter Einstand war, gab es dieses edle Wild in unserer Gegend nicht mehr.
Der Krieg spitzte sich zu und näherte sich der Katastrophe. Zum letzten Aufgebot gehörte auch Vater, den wir unter vielen Tränen an einem kalten, dunklen Wintermorgen zum Bahnhof brachten. Das Schicksal meinte es gut mit ihm. Erst wurde er in die Dolmetscher Kompanie zu Hauptmann Gerngroß nach München eingezogen, der in der Schlußphase durch einen Putsch (Vater war nicht involviert) gegen die „Endsiegler“ das Elend verkürzen und verbessern wollte, dann kam Vater mit Diphtherie bis zum Kriegsende zurück.
Mit dem Zusammenbruch und der Besatzung durch die Amerikaner schwiegen die Waffen endlich, aber auch zunächst bei der Jagd. Unsere historischen Waffen wurden registriert und abgegeben. Alle Feuerwaffen wurden konfisziert. Selber habe ich gesehen, wie die „Amis“ auf einem Stein Privatgewehre haufenweise zerschlugen. Natürlich hatten auch wir versucht, Gewehre, meist im „Weiher“ , zu verstecken. Von unliebsamen Entdeckungen ist mir nichts bekannt.
Das Wichtigste dieser Tage war, die gesunde Heimkehr der Soldaten. Und Gottlob tauchten auch u.a. unsere beiden Jäger Karl Schmitzer und Joseph Hilz nacheinander unbeschadet wieder auf. Joseph hatte mit 16 einen Lehre bei unserem alten Oberförster Schmitzer absolviert und wurde jetzt einstweilen – mit männlichen Aufgaben versehen – bei dem zahlreich im Schloß in Brot gebrachten Hauspersonal zwischengeparkt. Nicht zuletzt durch eine Finanzanleihe begann da unsere Freundschaft. Eines Tages bohnerte er im Großen Salon den Boden, als ich ihn bat, mit einem (Papier-) Zehnerl mir aus meiner Insolvenz zu helfen. Ich versprach ihm, es an meinem 20. Geburtstag zurückzuzahlen. Mit Zinsen bekam er es pünktlich zurück.
Aber bis dahin tat sich noch nicht viel rund um die Jagd in den Nachkriegsjahren. Während wir unbewaffnet unsere Spaziergänge mit Vater machen mußten, entdeckten die Besatzer zunehmend den niederbayerischen Wildreichtum. Unsre Hilflosigkeit in den pulverfreien Jahren dokumentiert ein Erlebnis mit Vater anschaulich. Eines Tages waren wir in der Kolmöd mit ihm unterwegs, da stürmten zwei jagende Hunde an uns vorbei. Vater zog seinen Knicker aus der Tasche und warf die „kalte Waffe“ nach einer der „Bestien“. Ungeübt in dieser Kunst, war die Wirkung kläglich.
Wöchentlich fuhren im Sommer 1945 jetzt Amis mit dem Jeep vor und wollten auf die Jagd gehen. Um sie von Schlimmerem abzulenken und sie bei guter Laune zu halten, gab man sein Bestes. Karl und Joseph fanden als Fährtenleser und Führer so einen neuen Weg in das Waidwerk.. Ein uniformierter „Nimrod“ fiel besonders auf. Mit Gewehr in Vorhalt trabte er in Nahkampfmanier durch die Landschaft. Kleinere Zuwendungen halfen, auch diesen Kulturschock zu überleben.
Als Chance zog der Zusammenbruch aber auch einen betrieblicher Neuanfang nach sich. Mit dem neuen Direktor Schreiner aus Böhmen wurde der gesamte Betrieb neu sortiert und neu aufgestellt. Der Forst bekam u.a. einen neuen Schwerpunkt. Es war nicht nur viel während des Krieges an Arbeit liegen geblieben, sondern zum Wiederaufbau stieg die Holznachfrage. Hinzu kam die neue Aufgabe, vor allem für die Flüchtlinge, Holzlesescheine auszugeben und zu kontrollieren. So stand zunächst bei unseren „Grünröcken“ der Förster im Vordergrund. Für den Wald wurden nicht nur die alten Holzfäller Sommer, Hopper … sondern auch neue wetterfeste Burschen eingestellt. Einer wurde von den anderen beinahe verdroschen, weil er immer noch braune Töne von sich spuckte.
Das war auch die Zeit wo ich anfing mich an Joseph zu halten und freie Zeit im Wald zu genießen. Wir gingen zu den Waldarbeitern, den „Kulturweibern“ (Frauen die in den Pflanzgärten arbeiteten) oder Bauern. Bei diesen Unternehmungen erzählte Joseph dann viel von seinem Russlandeinsatz. Wie er sich mit Kolonnen durch Sumpf und Winter kämpfte, gefangen wurde und sich befreien konnte, oder wie er sich nach dem Waffenstillstand nach Hause durchschlug. Es kamen aber auch schöne Tage vor, z.B. als er mit Hund in Russland eine Zeit lang jagen konnte. Dabei schoß er einen Sibirischen Rehbock, der ein viel stärkeres Gehörn als unser Rehwild trägt. Die in einem Urlaub mitgebrachte Trophäe wurde bei uns auf Gehörnschauen zur Dekoration später verwandt. Durch diese „Kriegsgespräche“ mit den Zeitzeugen bekam unsere Generation noch ein lebendiges Bild dieser Schreckensjahre an der Front.
Anders als bei den Ureinwohnern, den Sammlern und Jägern, fiel das Jagen ohne große Ernährungseinbußen die ersten Jahre aus. Wir glücklichen Landbewohner waren in der Regel so gut versorgt, daß trotz Teilen mit den Flüchtlingen auch für die „Hamsterer“ aus den ausgehungerten Städten noch etwas übrig blieb. Man paßte sich damals der veränderten Situation an und schenkte dem „ Sammeln „vermehrt Energie“. So trugen wir z.B. von den Pferdewiesen waschkorbweise Champignons nach Hause. Weniger beliebt bei mir waren die endlosen Beerenexkursionen. Bezeichnenderweise sagte einmal meine Mutter über Heidelbeeren gebückt zu mir: „ Du bist heute wieder stink faul“. Ich konnte nicht widersprechen und antwortete: „Faul schon, stink nicht“.
Eine andere Form des „Beutemachens“ war auch eine Folge der fehlenden Schußwaffen. Das „Fallenstellen“ wurde wieder verstärkt praktiziert. So gab es spannende Aktionen beim „Fuchsgraben“ am Bau oder beim Fangen des Habichts mit dem Korb. Auch das Tellereisen war damals noch sehr verbreitet. Hohe Kunst hingegen war die Jagd auf Wildschweine mit der Saufeder am Trichter. Verwandte in Westfalen wurden dafür von uns bestaunt. Ein Onkel bei Landshut schaffte sich eine Windhundmeute und eine Armbrust an, um auf Jagd nicht verzichten zu müssen.
Statt Jagen mit Feuerwaffen bekam auch Fischen Auftrieb. Bei einem Fest in unserem Haus war ein Hecht mit über 10 kg eine Attraktion. Nicht nur für ihn wurden Eichenbretter gefertigt, weil die Platten zum Servieren zu kurz waren. Auch lukullische Krebse kamen damals wiederholt auf den Tisch. Für manche sah das nach unpassender Schlemmerei aus. Für uns war es die Nutzung vorhandener Früchte der Natur. Verständlicherweise nahm die Wilderei in der „schlechten Zeit“ wieder zu. Zum Teil war sie traditionell verortet und konzentrierte sich auf einen Hof oder ein Dorf, zum Teil aber auch aus der Not geborene Nahrungsbeschaffung nicht Ansässiger. Joseph stellte einmal den Bauern L., der im Schnee „strumpfsockert“ seine Schlingen kontrollierte. Die Polizei hob hinterher seinen „Wildkeller“ aus. Schlingen wurden anläßlich einer Treibjagd auch später noch gefunden, oder man erfuhr von nächtlichem Unwesen mit Schüssen im Scheinwerferlicht.
Besatzer und Besetzte gewöhnten sich langsam aneinander, und das Verhältnis lockerte sich auf. So konnte ich dann zunächst mein Luftgewehr auf den Begleitgängen mit Joseph mitnehmen. Zum Beutemachen erwies es sich aber doch als untauglich. Beim Hochsitzbauen entdeckte ich dann eines Tages in Josephs Jackentasche einen merkwürdigen Gegenstand. Er hatte sich eine kleinkalibrige Scheibenpistole mit langem Lauf besorgt. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit durfte ich dabei sein, wenn er mit Anschlag an der Backe Tauben damit schoß. Auch die gab es damals in großen Flügen viel häufiger. Insgesamt war der Wildbestand erst durch die fehlenden Jäger dann durch die fehlenden Waffen ernorm angestiegen. Im Herbst fielen die Wildenten zu Hunderten auf den Gerstenfeldern ein und im Winter waren Rehsprünge mit 30/40 Stück keine Sensation.
Obwohl damals die vollen Scheuern noch weit weg, waren Reklamationen wegen Wildschäden unbekannt. Neue Tierarten wie die Bisamratten, Kormorane, Reiherarten oder Biber vermehrten sich. In den 50ern wurde das erste Wildschwein auf die Schwarte gelegt, bis dann in den 90ern ein kapitaler Keiler mit über 150 kg folgte. Leider starben zwischen den Kriegen aber auch heimische Tiere aus. Nach 1945 wurde die letzte Birkhenne noch um Holzham herum bestätigt. Verschwunden waren die Wachteln und der Fischotter z.B., später dann auch der Große Brachvogel und Bekassinen. Ein bei uns seltener Tannenhäher kam in den 80ern zur Strecke.
Aber noch sind wir nicht so weit. 1952 wurde dann die Jagd mit Feuerwaffen offiziell wieder zugelassen. Auch unsere historischen Waffen kamen zurück, überstanden aber mangels Tresor die Zeit mit vollem Haus nicht vollzählig. Vor Neustart der Jagd mußte noch das Reviersystem mit den entsprechenden Besitzverhältnissen neu geordnet werden. Wir konnten zunächst den alten Stand halten und hatten neben Eigenrevieren auch zugepachtete Gemeindejagden. Später sollte ich selber als Pächter mithelfen. Für eines der teuersten Reviere im Landkreis zahlten wir damals 12 DM/ha. Des weiteren gründete mein Vater für die örtlichen Jäger, die sich durch Flüchtlinge vermehrt hatten, eine Jägervereinigung. Vor allem die, die kein eigenes Revier oder ein anderweitiges Begehungsrecht hatten, durften bei uns jagen.
Die Wiederbewaffnung war spannend. Es gab damals keine Neuwaffen auf dem Markt und trotzdem entstanden erstaunlich selten Beschaffungsprobleme. Leider konnte auch der Büchsenmacher Wild nicht mehr helfen. Er war der letzte seiner Zunft in Arnstorf.
Die Mehrzahl der Gewehre wurde m. E. aus den Verstecken geholt, etliche Militärwaffen umfunktioniert und schließlich hatten die Amerikaner ihre M I Karabiner aus der Waffenschmiede von General Motor als „Jagdschutzwaffe“ ausgegeben.
Neben Waffen gehörten auch die vierbeinigen Jagdhelfer zur „Ausrüstung“ und so stand – sicher nicht ohne das Zutun meiner Mutter – eines Tages ein Irish-Setter im Hof. Damit trat „Alma“ in unser neues Jagdleben, ein für mich legendärer Hund. Ich habe nie einen besseren und sympathischeren gesehen. Er war absolut souverän auf der Schweißfährte und ebenso gut beim Vorstehen auf der Hühnerjagd. Die heißen Herbstjagdtage auf ihr mit Durst, kratzigem Kartoffelkraut in den Schuhen und Hühnerflöhen in der Hose vom Galgen am Bund sind unvergeßlich.
Alma brachte manche Kunststücke fertig. Sie konnte z.B. rohe Eier apportieren. Ihr absolutes Glanzstück brachte sie bei einem Feldbogen im Herbst fertig. Sie apportierte aus einem Kessel einen angeschossenen Hasen. Plötzlich sah sie einen weiteren angeflickten Hasen auf sie zukommen. Sie legt sich in eine Ackerfurche, legt den ersten Hasen ab und wartet die kürzeste Distanz ab. Dann schnellt sie aus dem Versteck und erlöst den Mümmelmann von seinen Leiden.
Die erste erfolgreiche Pirsch erlebte ich auch mit Joseph. Er führte einen deutschen Militärkarabiner, dessen Herkunft mir verborgen blieb. Um das Geschoß jagdtauglicher zu machen, wurde die Kupferspitze abgezwickt. Mit Karl fuhr ich eines Sommerabends auf seiner BMW 250 von der Pirsch zurück, da sah er schon nach Büchsenlicht am Waldrand einen Rehbock, den er haben wollte. Er richtete den Scheinwerfer auf ihn und schoß. Ich konnte die Kugel fliegen sehen, es war ein Leuchtspurgeschoß. Leider landete es nicht auf dem Bock. Karl konnte sich billig einen größeren Posten Munition organisieren, merkte aber erst hinterher, daß es Leuchtspurmunition war.
Ich denke, kriegsbedingt war das jagdliche Brauchtum, wenn nicht gerade das herrschaftliche Auge wachte, noch nicht so geschliffen wie heute. In die selbe Richtung geht eine Wette am hellichten Tag am Wirtshaustisch in einem kleinen Dorfgasthaus. Die bierschwangeren Bauern haben Karl provoziert und gewettet, daß er nicht in der Lage sei, ihnen in einer halben Stunde einen Rehbock zu präsentieren. Mutig ging er auf die Wette ein – und gewann.
Erwähnenswert ist auch die Motorisierung in Wald und Forst in Folge des Krieges. Erst mit Willys Overland Jeeps und Kübelwagen, dann mit geländegängigen Bundeswehrfahrzeugen wurde Zeit und Kraft gespart und Lärm und Körperfett vermehrt. Im Tegernseer Tal hab ich noch gesehen wie ein erlegter Hirsch mit einem Kettgrad abtransportiert wurde.
In den Tagen nach dem Zusammenbruch rasten die Jeeps „wie verrückt gewordene Nachtkasteln“ überall herum. Man kann es sich nicht mehr vorstellen. In Arnstorf gab es zu der Zeit lediglich eine Hand voll Autos, keine der Straßen nach Arnstorf war geteert und am Pfarrkirchner Berg stand noch ein Verkehrsschild, das den Einsatz des „Hemmschuhs“ für die Fuhrwerke forderte. Bis hin zu den SUV hat sich der Trend, sich wilde Natur und Gelände untertänig zu machen, durch Sumpf und Steppe zu preschen als Männerphantasie des 21. Jh. erhalten, auch wenn kaum freies Gelände mehr verfügbar ist.
Nicht mit Gewehr sondern mit Horn sollte ich zunächst selber in das Jagdgeschehen eingreifen. Mit Recht hatte sich mein Vater Besseres vorgestellt und so wurde ich nur einmal bei einer Treibjagd zum Einsatz gebracht. Meinen ersten Rehbock schoß ich dann im Alter von 15 mit der Bockbüchsflinte von Joseph bei Puch. Er hatte dieses treue Gewehr von Bauer Eduard erworben. Nach dem Schuß war ich etwas verdutzt, da ich den Bock nicht fallen sah. Joseph tröstete mich schnell mit der Mitteilung, daß das bei Blattschüssen in dem Kaliber immer so wäre. Dem jungen Sechser war es recht.
Der aktive, formale Eintritt in mein Jägerleben begann dann mit der Prüfung zum Jugendjagdschein 1956 im Nebenzimmer eines Schwarzwälder Gasthauses. Auf dem Weg in s Internat sollte ich mich dort der „Behörde“ stellen. Wir waren zu 5. Eine Schweizerin, ein Kurhausdirektor und zwei Bauern. Der Prüfer merkte schnell, daß bei mir Jagdpraxis und Wissen aus dem „Blase“ vergleichsweise gut zusammenfiel und so hüpfte ich locker über diese Schwelle.
Weihnachten darauf gesellte sich eine Sauer&Sohn Flinte unter dem Christbaum zu meinem schon vorher geschenkten Flobert. Ein paar Tage später auf einer Waldjagd schoß ich mit dem rechten Lauf der neuen Flinte einen Hasen und mit dem linken mit stärkerem Schrot einen Fuchs, der über den Weg flüchtete. Die fällige Fuchsmaß zahlte mein Vater sichtlich gerne.
Weihnachten darauf fragte mich Vater, wie ich meine Jagdausrüstung weiter vervollständigen wollte. Ich schlug dem „Christkind“ einen Repetierer vor. Ich bekam ihn im Kalieber 7 X 57. Später lieh ihn sich Vater einmal aus und schoß bei Prinz Eugen in Hinterstein eine Gams damit. Zu meiner Sauer & Sohn hatte mein rührender Vater, ohne davon zu sprechen, schon längst Wechselläufe gekauft. So riß Weihnachten mit Jagdutensilien nicht ab und ich hatte dann noch eine Büchsflinte. Das war der Einstieg in mein umfangreiches Waffenarsenal, das neben Zuerwerb auch aus den ausgelösten Waffen aus der Erbschaft meines Schwiegervaters, einem preußischen Forstmeister a.D., bestand. Das beste Stück darunter war eine englisch geschäftete Doppelbüchse, der ich in Landshut ein aktuelleres Kaliber verpassen ließ.
Erwachsen geworden, räumte mir Vater die Bejagung eines der schönsten Revierteile mit Wald , Feld, Wiesen und Weiher ein. Auch von dort stammen einige Medaillenböcke, die den Blick immer wieder auf sich ziehen und mich mit Dankbarkeit auf traumhafte Jagdjahre zurückschauen lassen.
Natürlich sind auch die unwiederbringlichen großen Treibjagden unvergeßlich. In Umfang und Stil lehnten sie sich noch an feudale Zeiten an. Statt UNIMOG gab es einen Wildwagen, Verwandte von weit und breit, Knödelbogen in ausgewählten Bauernstuben, Tee und abends großes Diner mit festlichem Tisch und Abendrobe im Schloß. Die Jäger servierten in Jagdlivree. Bei den Großen Jagden waren Strecken um 300 Stück nicht selten. In den besten Nachkriegsjahren kam in allen Revieren eine Strecke von über 1000 Hasen und 1000 Fasanen zusammen; Rehe waren es ca.400. Gemütlich ging es auch bei den „Portugiesen“ und Treibern nach der Jagd im Wirtshaus zu. Unter den Tischen träumten die Hunde und stöhnten manchmal auf . Ob wegen der Strapazen oder wegen der Jagdfreuden blieb ihr Geheimnis.
Im Hochsommer lebte das Jagdwesen auch mit der Brunft wieder auf. Da kamen dann
Verwandet ohne Revier aber mit viel Jagdphilosophie. Der über 90jährige Bruder meines Großvaters war der „profilierteste“. Diese alten Hasen zu führen und zum Schuß zu bringen, verlangte den Jägern auch menschliche Qualitäten ab. Mit Schnepfenstrich und Bisamjagd hatte das Jagdjahr eine Vielzahl von Gelegenheiten, die natürlichen Sinne zu schärfen und in die Geheimnisse von Natur und ihren Geschöpfen einzutauchen. Auf den Hochsitzen hatte ich oft meine kreativsten und seligsten Träume.
Auch wenn Jagd heute noch nicht zwischen Frieden und Krieg steht, benehmen sie viele Gegner ihrer Romantik und ungestörten Naturnähe. Das fängt mit der Versiegelung des Bodens an und geht über Verkehr, Umweltbelastung inklusive Lärm und intensive Landwirtschaft, Freizeitgewohnheiten, Schadensansprüche, Wildkrankheiten, Jagdrechtsänderungen, Auswüchsen bei Waffentechnik und Elektronik, auch verantwortungslosen Jägern, bis zu aggressiven Jagdgegnern mit Gewaltpotential. Bei Einsicht aller ließe sich manches wieder verbessern, aber das Paradies läßt sich nicht zurückgewinnen.