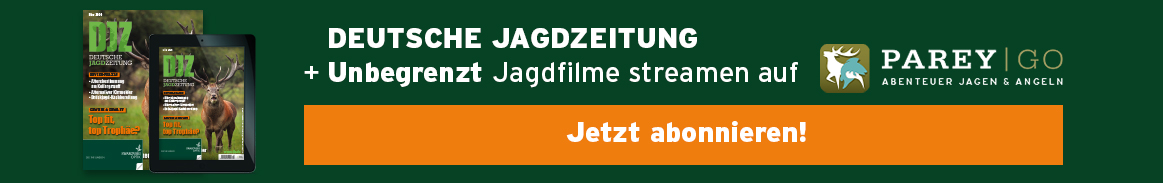Auf den Jagdmessen und in Jägerversammlungen werden von zahlreichen Feldjagdpächtern Klagen erhoben wegen eines vielerorts in angrenzenden Regiejagden betriebenen „Kreuzzuges“ gegen das Rehwild. Wie kann dieser Konflikt gelöst werden? – Oberforstmeister i. R. Dr. Günter Millahn
Die Feldjagdpächter beklagen, dass sie bei den bestehenden hohen Pachtbeträgen auf die Erträge aus dem Rehwildabschuss angewiesen sind, die Abschusspläne aber vielerorts nicht mehr erfüllen können, weil örtliche Rehwildbestände in den Regieforsten zusammengeschossen werden. Dieser seit Jahren bestehende Schwelbrand zwischen den„Wald-“ und „Feldjägern“ untergräbt die im Bundesjagdgesetz geforderten gemeinschaftlichen Hegebestrebungen.
Verbissschäden durch Rehwild werden oft überschätzt

Fotos: Hans-Joachim Steinbach / Dieter Hopf
Rehwild verursacht naturgemäß im Wald Verbiss- und Fegeschäden an Kulturpflanzen. Nicht jeder festgestellte Verbiss an Jungpflanzen ist aber wirtschaftlich gesehen ein Schaden am Wald. Je kleiner die Verjüngungs- oder Kulturfläche ist, um so schädlicher wirken sich solche Schäden aus. Deshalb sind rationelle Flächengrößen in der Walderneuerung immer günstiger als Anbau und Verjüngungen auf Kleinflächen. Allein durch eine optimale räumliche Ordnung von Verjüngungsflächen kann man oftmals drohenden, schweren Verbiss- und Fegeschäden vorbeugen. Rehwild ist wie andere Wildarten ein Standortsfaktor in unseren Forsten, den wir im Ökosystem Wald in örtlich angepasster Wilddichte zu erhalten haben. Es ernährt sich zum großen Teil durch Triebäsung. Findet es davon in seinen Biotopen zu wenig oder gar nichts, kann es in den Walderneuerungsflächen rasch zu unvertretbar hohen Verbissschäden kommen, besonders dann, wenn die Wilddichte den örtlichen waldbaulichen Verhältnissen nicht angepasst ist. Ich habe mich in meiner Dissertation mit den Auswirkungen von Verbissschäden eingehend beschäftigt. Einige Erkenntnisse seien hier genannt:
1. Verbiss durch Rehwild an Jungpflanzen wird in seinen waldbaulichen Auswirkungen häufig zu negativ beurteilt, wenn nur das augenblickliche „Verbiss-bild“ bewertet wird. Deshalb einen Kreuzzug gegen das Rehwild zu führen, ist nicht gerechtfertigt. Nach den Grundsätzen einer geordneten Forstwirtschaft hat der Eigner ein bestimmtes, geringes Schadensmaß hinzunehmen.
2. Der Verlust von Seitentrieben macht einer kleinen Kulturpflanze nicht viel aus. Auch durch Verlust des Terminaltriebes stirbt weder eine Nadelholz- noch eine Laubholzpflanze ab. Jahrelanger Verlust des Terminaltriebes stuft das Höhenwachstum zurück und führt zu besenwuchsartigen Kronenverformungen. Das erhöht die Gefahr des wiederholten Verbisses und damit des Ausfalls. Auf armen durchlässigen Sandböden können heruntergebissene Kleinpflanzen bei anhaltender Trockenheit vertrocknen.
3. Gehen verbissene Kulturpflanzen ein und fallen in der Kultur aus, liegt fast immer eine gleichzeitige Schädigung durch Verdämmung durch Gräser vor, die auch ohne Verbiss rasch zum Ausfall der Pflanzen führen können. Bei der Kiefer wirkt meistens auch gleichzeitig Schütte befall schwächend. In diesem standorts- und vegetationsbedingten Zusammenhang lassen sich Verbissschäden nur richtig beurteilen. Bei 100 prozentigem Verbiss einer Kultur kann als Ertragsverlust der Massenzuwachs an Vorrat eines Jahres veranschlagt werden.
4. Es ist kompetent zu beurteilen, ob ein Schaden im Rahmen des gesamten Vegetationsbildes in einem Forstort noch vertretbar ist, oder ob er nicht mehr ohne energische Gegenmaßnahmen hinzunehmen ist. Von nicht vertretbaren hohen Verbissschaden kann man nursprechen, wenn eine Verjüngung durch flächenweisen Totalverbiss garnicht erst ankommen kann oder angekommene Verjüngungen wieder vernichtet werden oder wenn Bestockungen durch jahrelangen starken Verbiss an Jungpflanzen nachhaltig, das heißt über Jahre und Jahrzehnte geschädigt werden, sodass das angestrebte Betriebsziel eines Bestandes qualitativ und quantitativ wesentlich geschädigt wird.
All diese kritischen Fälle treten viel seltener auf als die vielfach vorhandenen unwesentlichen, kleineren Verbissschäden, die im Waldwachstum einer Kultur bald überwunden werden.
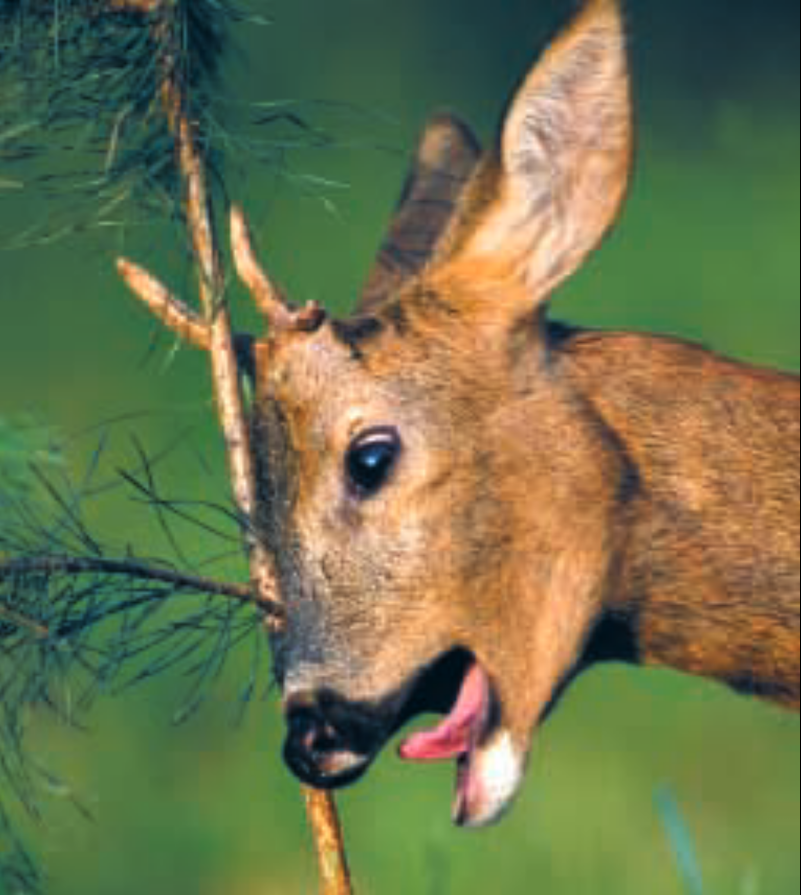
Fegeschäden durch Rehböcke sind ein natürlicher Vorgang und sollten nicht dramatisiert werden. Foto Manfred Danegger
5. In der Beurteilung von Verbissschäden kommt es allein darauf an, wie sich der Schaden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der Bestandesentwicklung auswirkt, und ob die Pflanzen der Verbissschere ohne besonderen Aufwand und ohne erheblichen Schaden entwachsen können. In allen Zweifelsfällen sollte man auf Schadbilder geringeren Ausmaßes nicht gleich mit Gegenmaßnahmen reagieren, jedoch ist der weitere Schadensfortgang unter Kontrolle zu halten.
6. Verbiss sieht anfänglich in Kulturen immer schlimmer aus, als er wirklich ist. Bis zu etwa 30 Prozent kann man einen Verbiss an den Jungpflanzen getrost tolerieren, weil sich die Bestockung erfahrungsgemäß trotzdem zukünftig schadlos entwickelt. Die sich dadurch ergebende Höhendifferenzierung ist ein ohnehin in der Bestockung naturgemäßer Vorgang. Die Mehrzahl der Bäume wird ja im Laufe des Bestandeslebens durch Pflegeeingriffe ohnehin entnommen. Früher durch mehrfachen Verbiss auch später noch sichtlich geschädigte Bäume werden dabei vorrangig genutzt.
7. Verbissschäden im Nadelholz wirken sich weitaus weniger aus als solche im Laubholz, wenn dieses zu Wertholz erzogen werden soll. In dicht bestockten Naturverjüngungen von Eichen, Buchen und Edellaubholz wirkt sich ein starker Verbiss in den ersten drei Jahren negativ aus. Das flächige Abäsen aller Keimblätter vernichtet aber spontan jede Verjüngung.
8. Alle Verbissschäden sind auch im Zusammenhang mit der nachbarlichen Umgebung zu bewerten, in deren Rahmen sie ihr Gewicht erhalten.
9. Als Gegenmaßnahmenkommen in kritischen Fällen, wie allgemein bekannt ist, entweder ein Reduktionsabschuss im betreffenden Forststandort, oder Gatterung der Schadflächen oder eine Verbesserung der Äsungsverhältnisse in Betracht.
10. Alle diese Maßnahmen kosten aber viel Geld und erheblichen betriebstechnischen Aufwand. Ob sie absolut notwendig sind und sich auszahlen, muss man sich an Ort und Stelle reiflich überlegen.
11. Jeder Verbissschaden durch Rehwild steht immer in enger Beziehung mit der Äsungsgrundlage im jeweiligen Forstort, die mit der Wilddichte in Einklang gebracht werden muss. Wo unvertretbar hohe Verbissschäden auftreten, ist in fast allen Fällen entweder die Wilddichte den Vegetationsverhältnissen nicht angepasst und die Bereitstellung von genügender Triebäsung im Revier versäumt worden. Letztere lässt sich leicht durch Mitanbau von Verbissgehölzen wie durch Verbissgärten und Anbau von Sträuchern anreichern. Die völlige Vernachlässigung des Anbaus von Sträuchern sowie der unterlassene Ausbau der Bestandesinnenränder mit Äsungspflanzen wie auch die Versäumung der Planung der Äsungsverhältnisse für das Schalenwild gehören forsteinrichtungstechnisch zu den gravierenden Sünden der ehemaligen Reinbestandswirtschaft. Diese Mängel sind beim Umbau in Mischwälder kontinuierlich in einem langfristigen Stufenprogramm zubeheben.
12. Sich der lästigen Verbissschäden durch angestrebten Totalabschuss in ganzen Forstorten entledigen zu wollen, indem die Waldjäger angewiesen werden, jedes vorkommende Stück Rehwild zu erlegen, ist auch heute weder zeitgemäß noch vereinbar mit ökologischer Denkweise im naturgemäßen Wirtschaftswald. Ein Altmeister des Waldbaus, Prof. Dr. Wagenknecht, der bezeichnenderweise nicht nur den Lehrstuhl für Waldbau sondern gleichzeitig auch den für Jagdkunde inne hatte, und der viele Förstergenerationen ausgebildet hat, bewertet diesen Sachverhalt wie folgt:
„Wer nur Waldbau ohne Wild betreiben kann, hat seinen Beruf verfehlt!“ Einen „Kreuzzug“ gegen das Rehwild zu führen, in dem in Regiejagden, die an Feldjagden angrenzen, der örtliche Rehwildbestand gnadenlos zusammengeschossen wird, muss aus mehrfachen Gründen abgelehnt werden, und wirft auch die Frage auf, wieviel uns Forstleuten und Jägern unser Wild noch wert ist.

Auf kleinen Flächen könnenjahrelange Verbisssituationentoleriert werden, die im gezeigtenFall auch durch Hochwildverursacht sind. Foto: Wolfgang Radenbach
13. Rehwild lässt sich auchörtlich nicht ausrotten, die Löcher ziehen sich von den Seiten her immer wieder zu. Es ist zeitgemäß, Rehwildbestände nicht wahllos zu liquidieren, sondern sie verantwortungsbewusst zu bewirtschaften. Das aber ist nur ab einer Bestandes dichte von mindestens vier Stücken pro l00 Hektar möglich. Kleinflächige Laubholzanbauten in großen Nadelholzkomplexen werden auch durch einzelne Rehe oft noch stark geschädigt und rechtfertigen eine Gatterung.
14. Wer auch das Geld für einige wenige Gatter im Revier nicht ausgeben kann oder will, ist offenbar seinem wirtschaftlichen Bankrott schon sehr nahe. Das seit Jahrhunderten bewährte Gatter total aus den Forsten verbannen zu wollen, ist ein Irrglaube und eine Fehlorientierung, der sich kluge Waldbauer nicht anschließen. Ein Kreuzzug gegen das Rehwild in an Feldjagden angrenzen den Forstrevieren ist eine Verletzung von Ethik und Moral in der Jagd unseres heutigen Revierjagdsystems, das eine kameradschaftliche Zusammenarbeit aller Jäger voraussetzt. Übrigens ist noch kein Forstbetrieb dadurch reicher geworden, in dem er sein Wild totschießt.
15. Können die Abschusspläne der Feldjagdpächter durch die angrenzenden Totalabschüsse nicht mehr erfüllt werden, schaffen wir statt Hegegemeinschaften Feindschaften, die leider vielerorts schon entstanden sind.
16. So wie die Höhe der Feldschäden durch Rot- und Schwarzwild von den Waldjägern wesentlich mitbestimmt wird, so sollten auch die Schalenwilddichten in den angrenzenden Forsten einvernehmlich und unter Mitsprache der Feldjagdpächter solidarisch festgelegt werden.
17. Dass es auch anders als durch einseitig betriebenen Totalabschuss geht, zeigen viele Forstämter, in denen bei laufend unterhaltener Äsungsverbesserung auch ein relativ hoher Rehwildbestand keine nennenswerten Wildschäden verursacht. Und das, obwohl nur wenige Verjüngungen gegattert werden, und ein gutes nachbarliches Verhältnis mit den Feldjagdpächtern gepflegt wird.
18. Es ist dringend erforderlich, dass über die Jagdbehörden und -verbände einheitliche Regelungen getroffen werden, die einer kompetenten Auslegung und Anwendung des Bundesjagdgesetzes auch zu diesem aktuellen Problem entsprechen.
Das Rehwild bewirtschaften! – Andreas Rockstroh

Feld-Wald-Kante: Nicht selten trennt diese Grenzlinie unterschiedliche Einstellungen dem Rehwild gegenüber. Foto: Michael Migos
Seit Jahren wird im Westen Deutschlands eifrig gestritten, wie man denn jagdlich mit dem Rehwild umzugehen habe. Nach der Wiedervereinigung schwappte diese Diskussion auch sehr schnell in den Osten, wo die Schalenwildbestände zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung höher waren als im Westen. Die Großraumlandwirtschaft zu DDR-Zeiten hat deutlich andere Lebensraumbedingungen für das Wild geschaffen als in den westlichen Bundesländern. Große Monokulturen im Osten haben großflächig das Niederwild auf Restbesätze zurückgedrängt, während die Schalenwildbestände, zumindest in der Vegetationszeit, optimale Lebensbedingungen vorfinden. Die Bewirtschaftung des Schalenwildes in den Jagdgesellschaften der DDR hat Spannungen zwischen Jägernin der Feldmark und denen im Walde ausgeglichen. Sie haben sich allerdings mit der Auflösung der Jagdgesellschaften und dem Pachtsystem verschärft.
Die beschriebenen Spannungen existieren zwar auch in den westlichen Bundesländern, aufgrund der meist strukturreicheren Feldmark aber nicht in dem Maße wie im Osten. Soweit einige Anmerkungen zum vorstehenden Beitrag von Dr. Günther Millahn aus Mecklenburg-Vorpommern. Doch kommen wir zum Rehwild. Dort, wo es aufgrund unterschiedlicher Interessenslage knirscht, haben wir sicherlich kein Rehwildproblem, sondern ein Rehwild-Jäger-Problem. Die Extremmeinungen reichen von: „Jedes Rehschießen, das man sieht“ bis zu „jagdlicher Zurückhaltung“, die darin gipfelt, dass man gelegentlich einmal einen Rehbock erlegt und das weibliche Rehwild eher „natürlicher Selbstregulation“ überlässt. Selbst die schärfsten Kontrahenten sind sich wohl darin einig, dass Rehwild in der Feldmark keine Wildschadensprobleme verursacht. Dort, wo sich ganzjährig Feldrehbestände etablieren, halte ich es deshalb für legitim, sie zurückhaltend zu bejagen, nicht zuletzt, um den Jagdwert dieser Feldreviere einigermaßen zu erhalten. Schwieriger zu beurteilen sind die Regionen, in denen große Feldreviere an große Waldreviere angrenzen. Dort wird sich die Schalenwilddichte im Winter im Wald deutlich erhöhen. Verständlicherweise habe ich für diese Situation auch keine Patentlösung parat. Einvernehmliche Lösungen wird man nur miteinander, nicht in Alleingängen, bewältigen. Die von Dr. Millahn genannte untere Bewirtschaftungsgrenze von vier Stück Rehwild pro 100 Hektar Waldfläche ist vielleicht ein Anhaltspunkt. Ich habe aber auch schon Forderungen nach einem Stück Rehwild auf 100 Hektar Wald als Zielwilddichte gehört. Auch ich halte solche Forderungen für unrealistisch und schädlich in der Diskussion der Beteiligten. Nach so viel Theorie hier einige Tipps für die Jagdpraxis:
Private Jäge erfüllen in der Regel ihren Bockabschussplan, aber bei manchen hapert es mit der Bejagung des weiblichen Rehwildes. Demzufolge ist das Geschlechterverhältnis oft zugunsten des weiblichen Wildes verschoben. Wer also in seinem Revier zehn Rehböcke erlegt, sollte (von den oben beschriebenen reinen Feldrehbeständen abgesehen) mindestens zehn weibliche Stücke in seinem Revier erlegen, aber nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich. Schwieriger sind für Außenstehende die Bedingungen in den verschiedenen Waldrevieren zu beurteilen. Wie sind die Biotopverhältnisse, welche wiederkäuenden Schalenwildarten kommen außer Rehwild vor? Habe ich viel oderwenig „jungen Wald“… und vieles mehr. Aber auch hier könnte man sich am realisierten Bockabschuss orientieren und je nach Geschlechterverhältnis und Wilddichte einen entsprechenden Prozentsatz an weiblichem Wild und Kitzen „aufpacken“. In Waldrevieren mit nicht überhöhten Hochwildbeständen ist ein nachhaltiger Rehwildabschuss bis zu zehn Stück pro 100 Hektar Waldfläche realisierbar, örtlich auch mehr. Dort, wo außer Rehwild noch zwei oder gar drei wiederkäuende Schalenwildarten vorkommen, wird in der Praxis der Jagdbetrieb auf Erfüllen der Hochwild-Abschusspläne ausgelegt sein. Mit sinkenden Hochwildbeständen wachsen aber erfahrungsgemäß die Rehwildbestände. Forderungen, Rehwild wie andere Niederwildarten ohne Ansehen von Geschlecht und Altersklassen zu bejagen, halte ich für falsch. Eine Klassifizierung des männlichen Wildes nach Bockkitzen, Jährlingen, mittelalten und alten Böcken, ist vernünftig. Beim weiblichen Rehwild genügt die Unterscheidung nach Kitzen, Schmalrehen und Ricken (Geißen). Auch die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorgaben (führende Stücke) darf nicht zur Diskussion stehen. Streitereien auf Hegeringversammlungen, ob ein Bock nun zwei-,drei- oder vierjährig ist, sind überflüssig. Wenn allerdings fast nur noch Jährlinge und Zweijährige vorgezeigt werden, sollte ein Nachdenken einsetzen.